Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…





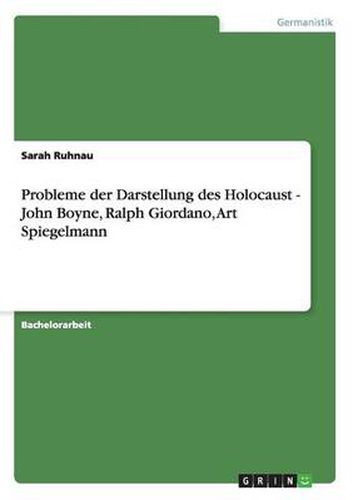
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 2.0, Ruhr-Universitat Bochum (Germanistisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung
Man kann nach Auschwitz nicht mehr atmen, essen, lieben, lesen …, so druckte Heinrich Boell seine Gedanken und Gefuhle gegen-uber dem Holocaust aus. Deutlich wird, dass Auschwitz eine Zasur darstellt; danach ist nichts mehr, wie es einmal war. Die alltaglichsten Dinge scheinen in diesem Licht nicht nur verandert, sondern gar unmoeglich. So stellt sich schnell die Frage, inwieweit denn das Schreiben nach Auschwitz noch moeglich ist, noch moeglich sein kann. Gibt es uberhaupt Worte fur die Schrecken, die die Opfer der Shoah tagtaglich erleben mussten? Und wenn ja, darf man sich anmassen, den Versuch zu wagen, die-ses Grauen in Worte zu kleiden? Ein Wagnis, das wird es wohl immer bleiben. Aber ist es gerechtfertigt, jegliche Literatur, die sich mit diesem Thema beschaftigt, zu verdammen oder gar zu verbieten? Adornos oft zitiertes Diktum, Gedichte nach Auschwitz zu schreiben sei barbarisch (Kiedaisch, 49) ist zwar kein Verbot, wie er spater feststellte, aber nichtsdestoweniger ein Rundumschlag gegen die Lyrik und bei genauerem Hinsehen auch gegen die Literatur und das Schreiben an sich. Adornos These wurde vielfach diskutiert und kritisiert, fand aber auch einigen Zuspruch. Oft wurde sie aus dem Zusammenhang gerissen und als rigides Verbot verstanden und infolgedessen mit Empoerung und Unverstandnis quittiert. Sicher ist jedenfalls, dass dieser Satz nicht unbeachtet blieb, vielmehr erregte er die Gemuter in der deutschen Literaturwelt. So moechte auch ich mich bei der Beurteilung drei ausgewahlter Beispiele aus der Literatur, vorwiegend von Adornos Diktum leiten lassen. Dies soll allerdings nicht auf die beruhmte These, es sei barbarisch (ibid) nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, beschrankt sein, sondern auch seine spateren Reaktione
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 2.0, Ruhr-Universitat Bochum (Germanistisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung
Man kann nach Auschwitz nicht mehr atmen, essen, lieben, lesen …, so druckte Heinrich Boell seine Gedanken und Gefuhle gegen-uber dem Holocaust aus. Deutlich wird, dass Auschwitz eine Zasur darstellt; danach ist nichts mehr, wie es einmal war. Die alltaglichsten Dinge scheinen in diesem Licht nicht nur verandert, sondern gar unmoeglich. So stellt sich schnell die Frage, inwieweit denn das Schreiben nach Auschwitz noch moeglich ist, noch moeglich sein kann. Gibt es uberhaupt Worte fur die Schrecken, die die Opfer der Shoah tagtaglich erleben mussten? Und wenn ja, darf man sich anmassen, den Versuch zu wagen, die-ses Grauen in Worte zu kleiden? Ein Wagnis, das wird es wohl immer bleiben. Aber ist es gerechtfertigt, jegliche Literatur, die sich mit diesem Thema beschaftigt, zu verdammen oder gar zu verbieten? Adornos oft zitiertes Diktum, Gedichte nach Auschwitz zu schreiben sei barbarisch (Kiedaisch, 49) ist zwar kein Verbot, wie er spater feststellte, aber nichtsdestoweniger ein Rundumschlag gegen die Lyrik und bei genauerem Hinsehen auch gegen die Literatur und das Schreiben an sich. Adornos These wurde vielfach diskutiert und kritisiert, fand aber auch einigen Zuspruch. Oft wurde sie aus dem Zusammenhang gerissen und als rigides Verbot verstanden und infolgedessen mit Empoerung und Unverstandnis quittiert. Sicher ist jedenfalls, dass dieser Satz nicht unbeachtet blieb, vielmehr erregte er die Gemuter in der deutschen Literaturwelt. So moechte auch ich mich bei der Beurteilung drei ausgewahlter Beispiele aus der Literatur, vorwiegend von Adornos Diktum leiten lassen. Dies soll allerdings nicht auf die beruhmte These, es sei barbarisch (ibid) nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, beschrankt sein, sondern auch seine spateren Reaktione